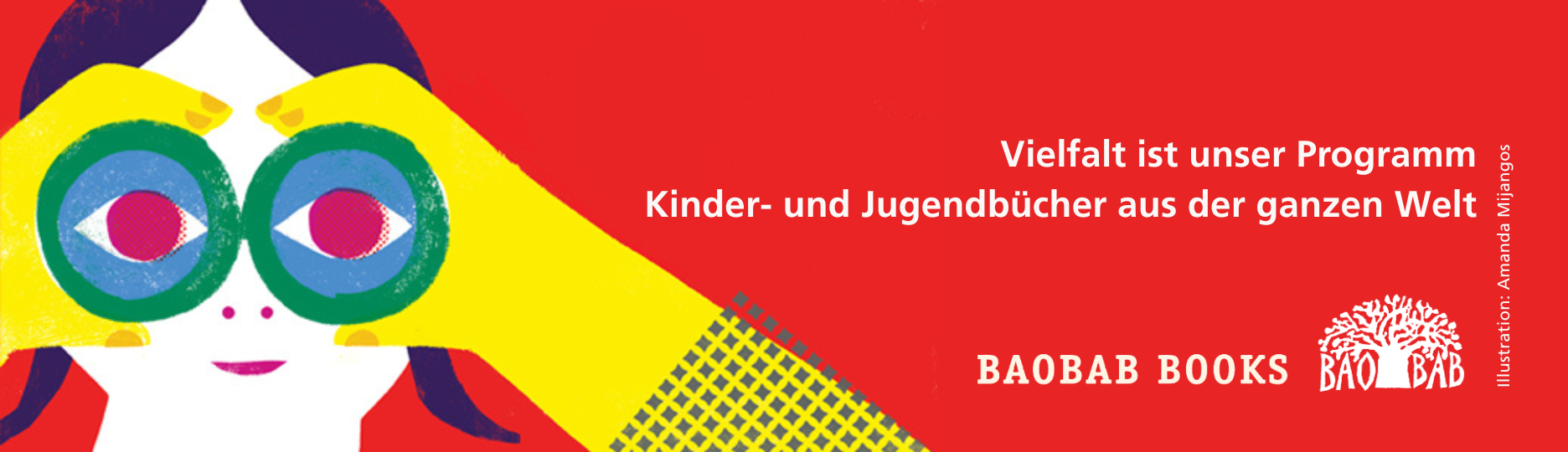33 Cent um ein Leben zu retten
33 Cent am Tag kostet es, einem hungernden Kind in Afrika das Leben zu retten. Eine fast simpel wirkende, mathematische Gleichung, die der Ich-Erzähler in Louis Jensen Roman aufmacht. Und nach der er fortan sein Handeln kompromisslos ausrichtet. Der Tipp von Heidi Lexe.
Stehlen ist nicht schwer. Doch stehlen ist verboten. Es ist auf den ersten Blick ein Generationenkonflikt, der sich zwischen einem männlichen jugendlichen Ich und dessen Vater, genannt "der Richter" entspinnt. Dahinter jedoch verbirgt sich eine scheinbar so simple Logik: 33 Cent am Tag kostet es, um einem hungernden Kind in den Krisengebieten Afrikas das Leben zu retten. Es wäre für den konsumorientierten Westen eine Leichtigkeit, dieses Geld aufzubringen. Warum also beutet die so genannte Erste Welt die Ressourcen der so genannten Dritten Welt aus, ohne ihr den entsprechenden Anteil am Gewinn zurückzuzahlen?
Auf eine Differenzierung dessen, was unter "Afrika" zu verstehen ist oder einen Diskurs über strukturelle Bedingungen der Armut in der Welt lässt sich der Text jedoch gar nicht ein. Grund dafür ist die konsequente Perspektivierung, die der bereits 1943 geborene und vielfach ausgezeichnete dänische Autor vornimmt: Das Erzählen folgt der Fokussierung des namenlos bleibenden Ich, folgt einem Jugendlichen, der keinen Blick mehr hat für etwas anderes als die verzweifelte Erkenntnis, dass mit 33 Cent das Leben eines Kindes für einen Tag gerettet werden kann. Sein Handeln folgt ausschließlich der Maxime dieser mathematischen Möglichkeit und dem Wunsch, seine KHK, seine Kassa hungernder Kinder mit entsprechenden Mitteln aufzufüllen.
Verzweiflung über die Gleichgültigkeit der westlichen Gesellschaft
Die ethische Frage nach dem Kontrast einer westlichen Wohlstandsgesellschaft und den entindividualisierten sterbenden Kinder Afrikas, die im Fernsehen gezeigt werden, ist diesem Handeln ebenso implizit wie die Verzweiflung über die Gleichgültigkeit dieser westlichen Gesellschaft. Expliziert wird hingegen die ethische Frage, welche Mittel angewandt werden dürfen, um zu helfen: Darf das Ich, das Verantwortung für diese Ungleichheit der Weltgemeinschaft übernimmt, von den Reichen nehmen und den Armen geben? Zahlreiche Re-Lektüren des Abenteuerromans "Robin Hood" führen immer und immer wieder zur Selbstüberzeugung: Im Sinne der guten Tat ist der Diebstahl unausweichlich – auch wenn sich gerade darin stets aufs Neue die aus der Verzweiflung entspringende Naivität des Handelns zeigt. Also nimmt das Ich von den Reichen, bestiehlt globale Textilketten und Boutiquen, verkauft die Stücke am Schwarzmarkt und füllt mit dem Geld seine KHK.
Gerade diese Naivität wird zum Movens des Erzählens von Louis Jensen: Weder ein reflexiver realistischer Jugendroman emanzipatorischen Zuschnittes ist sein Anliegen, noch eine zwischen Utopie und Dystopie gelagerte Erzählvariante, die einem im Geiste von Attac agierenden Jugendlichen folgt. Vielmehr erzählt er mit jener Herbheit, die (aus der Sicht der deutschsprachigen Jugendliteratur) schon den vieldiskutierten, ebenfalls aus Dänemark stammenden Roman "Nichts" von Janne Teller geprägt hat. Kurze, in ihrer Adjektivlosigkeit immer wieder beinahe emotionslos wirkende Sätze und kurze Kapitel, die sich einem Erzählfluss verweigern, prägen den Text. Sprunghaft und doch der mathematischen Logik des Ichs folgend werden hier Wahrnehmungen, Überlegungen und Handlungen summiert, werden in die erzählerische KHK geworfen, um als Summe xxx zu ergeben.
Unausweichlicher Wunsch zu handeln
Beide – das Bemühen um die KHK wie auch das diesem Bemühen entsprechende Erzählen – münden in den unausweichlichen Wunsch konkreten Handelns, das das strukturpolitische Missverständnis des erzählenden Ichs auf die Spitze treibt: Der Wunsch, den Reichen zu nehmen und den Armen zu geben, der so klar und deutlich und logisch erscheinenden Lösung zu folgen, führt zu einer Fahrt nach Afrika, die genau das leisten soll. Unzählige Male hat der Ich-Erzähler sich den Weg von Dänemark (auf der ganz schemenhaften Landkarte, die Teil der Textgestaltung ist, scheint er von Seeland aus zu starten) nach Afrika überlegt; das Losfahren erfolgt dennoch ohne jede Planung, ja sogar ohne eigentlichen Entschluss als Spontanhandlung. Ein Kühlwagen, der Gemüse und Obst in jenen Supermarkt bringt, in dessen Lager das Ich arbeitet, um seine KHK zu füllen, bietet sich aus der Situation heraus an und schon ist das Ich auf dem Weg nach Süden.
Die Erzählhaltung legt nahe, dass vom Ende dieser Reise her erzählt wird – in Kenntnis des Endes dieser Reise also. Daher wohl auch der pragmatische, vielleicht sogar einer therapeutischen Zwangssituation entspringende Ton. Mit Blick auf die Fahrt nach Süden, mit Blick auf das tragische Ende hin, bekommt das Erzählen dann auch gerade hier neue Komponenten: Anne, die Freundin des jugendlichen Ichs, erhält die Bedeutung einer Gefährtin, die nicht fragt, die wie einst die Fischer am See Genezareth die Familie verlässt (von der wie auch dort nie die Rede ist) und jenem folgt, auf dessen eigenwilliger Mission mit Unverständnis reagiert wird. Und: "Wenn es Gott nicht gibt, dann muss doch einer tun, was er getan hätte."
Erzählerische Kompromisslosigkeit
Eine märchenhafte Fahrt in den Frühling scheint die Reise zu sein. Dass die zahlreichen glücklichen Küsse die Lippen des Ich bluten lassen, scheint die Worte der Bekenntnis nur zu unterstreichen. Dieses Blut jedoch nimmt unheilvoll vorweg, dass die Kompromisslosigkeit des Handelns der beiden Jugendlichen auch zu erzählerischer Kompromisslosigkeit – und damit zum tragischen Ende – führen wird. Der erzählerisch wie das Aperçu einer letzten Ausfahrt wirkende Tod Annes verleiht dem Roman dann auch jenen mythologischen Charakter, in dem eine am Realismus jugendlichen Alltags gemessene Wahrscheinlichkeit aufgehoben wird.
Bestätig wird diese Lesart durch die Figur der weißen Dame, die von den beiden Jugendlichen mitgenommen und der im Erzählen das Moment des Transzendenten zugewiesen wird.
Der Tag, an dem die beiden mit ihrem Kühlwagen von Gibraltar aus nach Afrika übersetzen, wäre der Tag der Konfirmation im Leben des Ichs gewesen – jener Tag also, an dem das stellvertretend von den Eltern in der Taufe abgelegte Bekenntnis eigenverantwortlich bekräftigt wird. Dieses Bekenntnis wird hier auf die Ebene moralischen Handelns transformiert; dieses Handeln wiederum steht in Opposition zum Gesetz. Als Gleichnis gelesen erinnert der Text also an das Handeln jenes Jesus von Nazareth, das auch in Opposition zu den (religiösen) Gesetzen der damaligen Zeit stand.
Mit dieser Lesart widersetzt sich der Text auch jener realistischen Lektüre, von der der Verlag sich in den Para- und Metatexten "Wichtigkeit" erhofft. Denn gelesen werden kann "33 Cent um ein Leben zu retten" weniger als Aktionsanlass, als vielmehr als Provokation jenes Diskurses, der auf der Handlungsebene selbst negiert wird – dem Diskurs über Entwicklungszusammenhänge und der daraus resultierenden Frage: Welche Handlungsmöglichkeiten hat ein einzelner / eine einzelne? Und wie kann dieser / diese einzelne dazu beitragen, dass politische Verantwortung übernommen wird? Denn mit einer Grundhaltung rechnet das erzählende Ich wortwörtlich ab: Ich alleine kann nichts ausrichten.
Fachredaktion
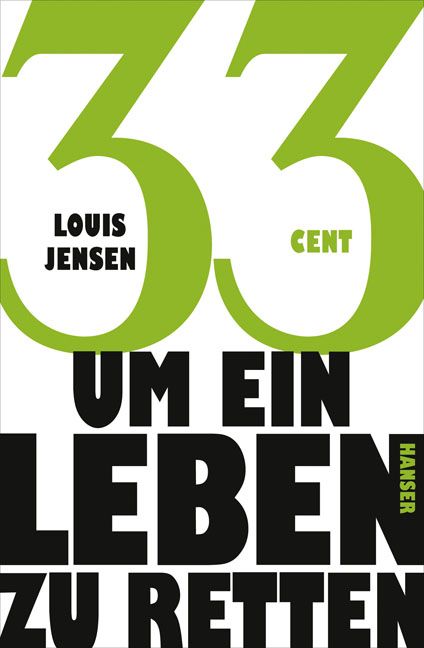
-
Titel33 Cent um ein Leben zu retten
-
Autor:inLouis Jensen
-
VerlagHanser
-
Erscheinungsdatum2013
-
Seiten160
-
Übersetzer:inSigrid Engeler
-
Bewertung